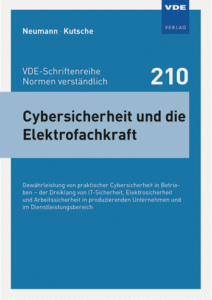Für den Einsatz von mobilen Luftreinigern während der Corona Pandemie in Unternehmen, Schulen oder Behörden muss der Arbeitgeber, die Schulleitung, die Leitung der Behörde, eine Gefährdungsbeurteilung erstellen.
Aerosole als Übertragungsweg
Aerosole sind ein gasförmiges Gemisch aus winzigen Schwebeteilchen. Beim Sprechen werden neben Tröpfchen (> 5 µm) auch Aerosole (0,3 bis 5 µm) mit an die Raumluft abgegeben. Dabei kann es sein, dass in diesen Aerosolen Viren enthalten sind. Aerosole werden als einer der wesentlichen Übertragungswege für SARS-CoV2 angesehen.
Mit Luftreiniger könnten sich Schulen wieder öffnen lassen
Luftreiniger können Viren aus der Raumluft filtern, sodass der Übertragungsweg über Aerosole unwahrscheinlicher wird oder ganz wegfällt. Der Einsatz von Luftreinigern kann somit dazu führen, dass Innenräume wieder von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden können und zum Beispiel Schulen für kleinere Gruppen wieder Präsenzunterricht anbieten können.
Warum braucht ein Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung für Luftreiniger?
Jeder Arbeitgeber in Deutschland muss die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen für seine Beschäftigten ermitteln (lassen) und dann diesen Gefährdungen entgegenwirken. Das schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor (vgl. § 5 ArbSchG).
Gefährdungsbeurteilung nach SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
Es gibt eine Anzahl von Verordnungen, die das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen besonders anordnen. Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel fordert eine Erstellung neuer bzw. Aktualisierung bestehender Gefährdungsbeurteilungen für alle „erforderlichen Maßnahmen des betrieblichen Infektionnsschutzes“. Der Einsatz von Luftreinigern ist eine solche Maßnahme.
Gefährdungsbeurteilungen machen Sinn
Abgesehen von der gesetzlichen Verpflichtung sind Gefährdungsbeurteilung sinnvoll. Sie zwingen dazu, sich systematisch über mögliche Gefahren Gedanken zu machen und sie zu unterbinden. Wird die Gefährdungsbeurteilung schon vor der Beschaffung durchgeführt, kann sie dazu führen, dass die Gefährdungsbeurteilung schlanker ausfällt und weniger Maßnahmen notwendig sind. Wer zum Beispiel einen Luftreiniger einkauft, der seine Filter nicht durch Erhitzen reinigt, braucht ggf. keine zusätzlichen Raumkühler für den Sommer beschaffen oder wer Raumluftreiniger kauft, die über eine Selbstüberwachung der wesentlichen Bauteile verfügen, kann etwa auf arbeitstägliche Sichtprüfungen der Luftreiniger verzichten. Beides wären Maßnahmen, die aus einer Gefährdungsbeurteilung folgen könnten.
Aufbau der Gefährdungsbeurteilung
In der Gefährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber alle möglichen Gefahren erfassen, bewerten und präventive Maßnahmen festlegen.
In der Gefährdungsbeurteilung werden auch die Wartungzeiträume für den Luftreiniger festgelegt. Günstigenfalls richten sie sich nach den Herstellerangeben.
Betriebsanleitung
Abgeleitet aus den ermittelten und bewerteten Gefährdungen werden bestimmte Maßnahmen. Das kann etwa die arbeitstägliche Sichtkontrolle des Luftreiniges sein oder der Umgang mit Störmeldungen. Es ist jedenfalls schwer vorzustellen, dass es keine Betriebsanleitung für einen Luftreiniger benötigt wird, in der den Beschäftigten Informationen zum Luftreiniger und Handlungsanweisungen bei Störungen gegeben wird, insbesondere was zu tun ist, wenn der Lufreiniger sich selbst abschaltet oder ausfällt.
Gefährdung durch Einatmen von virenbelasteten Aerosolen
Eine Gefährdung, denen Beschäftigte während der Corona-Pandemie ausgesetzt sein könnten, sind infektiöse Aerosole. Beschäftigte könnten sie in den Räumen einatmen, in denen sie ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Das Einatmen von infektiösen Aerosolen ist ein Übertragungsweg für Covid-19. Eine technische Gegenmaßnahme wäre der Einsatz von Luftreinigern.
Voraussetzung dafür, dass die Luftreiniger in der Lage sind diese Gefährdung zu bannen ist, dass sie
- technisch in der Lage sind, Partikel von der Größe eines Virus aus der Luft zu filtern (sie müssen also Partikel wie Viren mit einer Größe von max. 160 nm filtern können),
- in kurzer Zeit, die Luft des Raumes auch wirklich zu reinigen.
Gefährdungen durch Luftreiniger
Grundsätzlich darf von Luftreinigern keine Gefahr für Beschäftigte, Kunden oder Lieferanten ausgehen. Wenn im folgenden von Gefährdungen die Rede ist, dann sind das meist Szenarien, die beim Einsatz bestimmter Bauarten eintreten könnten. Welche das sind, hängt von der Technik der eingesetzten Geräte, ihrer Bedienung sowie den Aufstellorten ab.
Übrigens gilt auch: Je sicherer ein Luftreiniger ist, desto einfacher wird die Gefährdungsbeurteilung. Insofern macht es Sinn, sich vor der Beschaffung Gedanken zu machen, welche Qualitätskriterien ein Luftreiniger erfüllen muss. Eine Aufstellung, über welche technische Ausstattung ein Luftreiniger verfügen muss, finden Sie hier.
Da nicht alle Bauarten, Aufstellorte und Organisationsstrukturen berücksichtigt werden können, folgen hier einige Beispiele für mögliche Gefährdungen und welche Gegenmaßnahmen in einer Gefährdungsbeurteilung definiert werden könnten.
Austritt von giftigen Substanzen
Bei einigen Luftreinigern besteht die Möglichkeit, dass unerwünschte Reaktionsprodukte austreten könnten. Gemeint ist damit meist Ozon. Dieses Szenario ist gewissermaßen einer der Standardbefürchtungen wenn die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) über den Einsatz von Luftreinigern schreibt.
Eine Luftreinigung auf der Basis von Ozon, kaltem Plasma, Elektrofiltern oder Ionisation ist nicht zu empfehlen, da unerwünschte Reaktionsprodukte freigesetzt werden können.
DGUV, SARS-CoV-2-Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumplätzen
Sollte für einen Luftreiniger, der die Raumluft selbst oder seine Filter mit Ozon reinigt und der in Räumen mit Personen eingesetzt wird, eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden müssen, dann wäre zu fragen, wie der Gerätehersteller gewährleistet, dass kein Ozon austritt.
Ozon durch Ionisatoren
Einige Ionisatoren bilden gezielt Ozon, um bestimmte Gerüche in der Raumluft zu vermeiden. Es könnte auch zu einer ungewollter Ozonbildung in Ionisationsgeräten kommen. Die Richtlinie VDI 6022 Blatt 5 empfiehlt, beim Einsatz von Ionisatoren unter Umständen die Ozon-Emissionsrate zu bestimmen.
Ozon durch UV-C-Licht
Ozon kann allerdings auch entstehen, wenn UV-C-Licht mit einer Wellenlänge unterhalb von 200 nm verwendet wird. UV-C-Strahlung mit dieser Wellenlänge spaltet Sauerstoffmoleküle. Ihre Rekombination bildet Ozon.
Wenn daher Luftreiniger mit UV-C-Lampen gekauft werden sollen, dann müssen diese UV-C-Strahlen mit einer Wellenlänge von etwa 254 nm emittieren. Bei den meisten modernen Geräten ist dies auch der Fall.
Austritt von UV-C-Strahlen
Auch UV-C-Strahlen können Menschen schädigen. Daher müssen die Strahlenquellen in einem Luftreiniger abgeschirmt sein (Herstellernachweis). Sicherer sind Geräte, in denen zusätzlich Sensoren die Funktionstüchtigkeit der UV-C-Lampe überwachen und im Falle eines Defekts Warmeldungen abgeben oder den Luftreiniger abschalten.
Brandschutz
Alle Geräte, die Luft transportieren, sind im Falle eines Brandes potenziell gefährlich. Die Frage für die Checkliste bei der Beschaffung lautet: Schaltet sich der Luftreiniger im Falle eines Brandes automatisch ab?
Technische Ausstattungsmerkmale von Luftreinigern, die sich Fall eines Brandes abschalten sind zum Beispiel Rauchmelder an der Ansaugstelle und Temperatursensoren in den Filtern.
Gefährdungsbeurteilung für Luftreiniger ohne Abschaltautomatik im Brandfall
In einer Gefährdungsbeurteilung müsste die Gefährdung, die von einem Luftreiniger ohne Abschaltautomatik im Brandfall ausgeht, bewertet werden. Dann könnte man überlegen, mit welchen Maßnahmen dieser Gefährdung begegnet werden könnte. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Brandes gering ist, so ist der mögliche Schaden immens. Eine Möglichkeit wäre per Betriebsanweisung die Beschäftigten zu verpflichten, die Luftreiniger im Falle eines Brandes abzuschalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Feuer oder einer starken Rauchentwicklung dies vergessen wird, ist als hoch einzuschätzen. Fazit: Luftreiniger, die über keinen Brandschutz verfügen, dürfen nicht eingesetzt werden.
Gefährdungen durch thermischer Dekontamination
Allerdings gibt noch es noch andere potenzielle Gefahren. Luftreiniger nutzen Filter, um Partikel von der Größe eines Virus aus der Luft zu filtern. Das heißt, die Viren bleiben in den Filtern hängen. Diese wiederum müssen gereinigt werden. Es gibt Luftreiniger, die sie durch Hitze abtöten wollen. Dabei werden die Filter auf über 85 Gard Celsius erhitzt. Neben einer schnelleren Materialermüdung der Filter sorgt das für Hitzenester. Soweit bekannt, ist bisher durch keine Studie belegt worden, dass diese Methode der thermischen Dekontamination zuverlässig die in den Filtern angesammelten Viren tötet. Wissenschaftlich gesichert ist bisher, dass UV-C-Strahlung Viren unschädlich macht, indem sie die RNA der Viren zerstört. Daher sollte diese Methode bevorzugt werden – wobei auch die UV-C-Lampen so abgeschirmt sein müssen, dass keine Strahlung austritt. Zusätzlich müssen die UV-C-Lampen mit Sensoren überwacht werden und eine Fehlfunktion muss zu einem Alarm oder zum Abschalten des Luftreinigers führen.
Beispiel für präventive Maßnahmen für Luftreiniger mit thermische Dekontamination
Sollten Luftreiniger angeschafft worden sein, die sich thermisch dekontaminieren, dann muss dies in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden und verschiedene Maßnahmen wären denkbar:
- zusätzlicher Einsatz von Klimaanlagen im Sommer (wie es manche Gebäude- und Brandschutzversicherer für diese Bauart von Luftreinigern verlangen),
- eine Betriebsanweisung, die arbeitstägliche Kontrollen der Filter vorschreibt,
- kürzere Wartungszeiträume,
- sollte der Luftreiniger in einem Raum so aufgestellt werden, in dem er von Personen berührt werden kann, ist ein Berührungsschutz für die Bereiche unabdingbar, die erhitzt werden (sofern das Gerät nicht selbst über einen solchen Schutz verfügt).
- Arbeitsanweisungen für die Reinigungskräfte
Gefährdungen, die von Fehlfunktionen ausgehen können
In Luftreinigern kann es aus verschiedenen Gründen zu technischen Defekten kommen. Zum Beispiel können Filter brechen. In der Folge können Viren, die eigentlich in den Filtern aufgefangen werden sollten, in dem Innenraum verteilt werden. Die Filter in Luftreinigern müssen auf mögliche Filterbrüche überwacht werden und eine Abschaltung des Luftreinigers die Folge sein, wenn Filter beschädigt sind oder nicht mehr fehlerfrei funktionieren.
Gefährdungen, die von einem fehlerhaften Umgang mit dem Luftreiniger ausgehen können
Soll der Luftreiniger möglichst viele Aerosole mit Viren aus dem Innenraum filtern, muss er damit beginnen, sobald sich Personen in dem Innenraum aufhalten. Oft wird vergessen, die Luftreiniger einzuschalten. Es könnte also sein, dass die Raumluft gar nicht gereinigt wird.
Aufwendige Betriebsanweisung oder Startautomatik
In einer Gefährdungsbeurteilung könnte als Maßnahme eine Betriebsanweisung sein, die das Einschalten des Luftreinigers vor dem Beginn der jeweiligen Tätigkeit in dem Raum vorschreibt. Sicherer wäre ein Luftreiniger, der automatisch startet, sobald sich Personen im Raum befinden.
Gefahr durch Unachtsamkeiten und Vandalismus
Eine andere Gefährdung ist die Beschädigung des Luftreinigers durch die Personen, die sich in demselben Raum aufhalten. So werden etwa Kleidungsstücke auf Luftschlitze gelegt, in Schulen kann es auch vorkommen, dass Kinder Gegenstände wie Papierschnipsel in die Lüftungsschlitze stecken.
Automatische Warnhinweise
Werden Luftreiniger in Innenräumen aufgestellt, in den sich Kinder oder tödlich gelangweilte Erwachsene aufhalten und haben diese Zugang zum Luftreiniger, sollten solche Geräte beschafft werden, die über Sensoren verfügen, die Störungen verabeiten und Warn- und Störmeldungen senden.
Werden Geräte ohne solche Sensoren eingesetzt, muss dies in einer Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden und etwa eine verstärkte Aufsicht und/oder arbeitstägliche Kontrollen festgelegt werden.
Fazit
Luftreiniger können zu einer Öffnung von Geschäften und Schulen einen wichtigen Beitrag leisten. Ohne organisatorischen Aufwand ist ihr sicherer Betrieb allerdings nicht möglich. Neben einem Beschaffungsprozess, der sich an Qualitätskriterien orientiert, ist eine Gefährdungsbeurteilung notwendig. Dabei gilt, je sicherer der Luftreiniger ist, desto einfacher ist die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung.
Das könnte Sie auch interessieren: